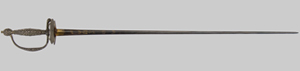Vergoldetes reich verziertes, zierliches Bügelgefäß mit Fingerhaken, Metallhilze. Zweischneidige Klinge 19 mm, Reste von Ätzung, gereinigte Narben. Reparierte Lederscheide mit gelben Beschlägen und Koppel-Spange. Länge 96,5 cm.
Kategorie: Blankwaffen
Degen-690
Degen-690 Degen-690, Offiziersstichdegen um 1760. Dreikantige, gebläute Colichmarde-Klinge. Aufwändig verarbeitetes Silbergefäß aus gegossenen Teilen zusammengesetzt. Aufwändig ziseliert und mit filigranen Zierdurchbrüchen versehen. Gitterförmig durchbrochenes Doppelstichblatt mit floralen Elementen. Kleine Fingerbügel, leicht nach unten geneigte Parierstange, der Mittelsteg mit herausgearbeiteter Schneckenform. Der Griffbügel mit in sich verschlungenen Bändern gestaltet. Fein durchbrochener Knauf, ebenfalls mit Schneckenmuster. Der Griff… Degen-690 weiterlesen
Degen-655
Degen-655 Degen-655, Galanteriedegen mit Silbergefäß, Frankreich um 1770. Gekehlte Dreikantklinge, gebläut mit vergoldeter Floralätzung, etwas angelaufen. Massiv silbernes Bügelgefäß mit diamantiert geformten Silberperlen, das nierenförmige Stichblatt auf der Außenseite mit gestricheltem Dekor. Mehrere Punzen. Gute Qualität. Länge 93 cm. Galanterie-Degen der oben gezeigten Art wurden vor allem in Frankreich und England hergestellt. Hierzu wurden die Gefäße… Degen-655 weiterlesen
Degen-764
Degen-764 Degen-764, Europa um 1680. Der Galanteriedegen hat eine schmale Stichklinge von rhombischem Querschnitt. Auf der langen zweifach gekehlten Fehlschärfe sind ornamentale Messing-Tauschierungen (teilweise ausgefallen) eingehämmert. Das eisengeschnittene Gefäß wurde mit kunstvollen Zierdurchbrechungen versehen. Auf dem asymetrischen Stichblatt ist zwischen Pflanzenornamenten in einem Medaillon das Porträt einer antiken Frau eingemeiselt. Weitere Porträtdarstellungen sind auf dem… Degen-764 weiterlesen
Degen-650
Degen-650 Degen-650, Spanien um 1670. Schlanke zweischneidige Klinge mit Mittelgrat, im ersten Drittel gekehlt mit Inschrift „Sebastian Hernandez“ (im spanischen Stil) neben Klingenzier. Eisengeschnittenes Gefäß mit waagrechter, kurzer Parierstange und reich durchbrochenen nierenförmigen Stichblättern mit Rocaillien. Fingerringe, feine Eisendrahtwicklung mit Türkenbünden. Walzenförmiger, floral geschnittener Knauf. Eleganter Stichdegen in guter Qualität. Länge 94 cm. Der berühmte… Degen-650 weiterlesen
Stich-Degen-624
Stich-Degen-624 Stich-Degen-624, deutsch um 1670. Schmale, zweischneidige Klinge, im oberen Viertel linsenförmig mit messingtauschierten Ornamenten, im weiteren Verlauf hexagonal mit Marken und in Messing eingelegter Schrift, terzseitig: „DEM HERREN DEM ICH DIEN’ DEM OPFRE ICH AUCH MEIN LEBEN“ quartseitig: „DIE SEEL’ ABER DEM DER MIR SIE HAT GEGEBEN“ (einige Messing-Buchstaben fehlen). Äußerst filigran gearbeitetes Gefäß… Stich-Degen-624 weiterlesen
Spund-Bajonett-684
Spund-Bajonett-684 Spund-Bajonett-684 europäisch um 1700. Frühes Bajonett zur Verwendung bei der Jagd. Nach dem Abfeuern eines Schusses konnte man das Bajonett mit dem Griff (Spund) in den Gewehrlauf stecken und zum Stich gegen das Wild einsetzen. Gerade Rückenklinge (korrodiert) mit breiter Hohlkehle und zweischneidiger Spitze. Reichhaltige Zierätzung und Vergoldung auf dem gesamten Klingenblatt bis zur… Spund-Bajonett-684 weiterlesen
Hirschfänger-707
Hirschfänger-707 Hirschfänger-707, deutsch, Mitte 18. Jahrhundert. Lange, gerade und zweischneidige Klinge mit linsenförmigem Querschnitt. Auf der Klingenwurzel geätztes Bandelwerk, daran anschließend jagdliche Ziergravuren von Hirschen und Wildschweinen, die durch Jagdhunde verfolgt werden. Mit Voluten und Ranken geschmücktes, vergoldetes Messinggefäß. Auf den Klingenschultern ruht die Stoßplatte mit der Parierstange. Diese ist gerade mit nach unten eingerollten… Hirschfänger-707 weiterlesen
Hirschfänger-640
Hirschfänger-640 Hirschfänger-640, barocke Jagdwaffe aus Österreich um 1730 Stattliche Seitenwaffe mit gerader Rückenklinge, beidseits doppelt gekehlt, mit je einer breiten und einer schmalen Hohlkehlung. Der auslaufende Rückenschliff ist ca. 20 cm lang. Die an die Klingenschultern anschließende ungekehlte Partie zeigt in rechteckigem Rahmen fein eingeätzte Jagdszenen, terzseitig ein Wildschweinjagd, auf der Qartseite eine Hirschhatz mit… Hirschfänger-640 weiterlesen
Hirschfänger-774
Hirschfänger-774 Hirschfänger-774, mitteleuropäisch um 1680 Eisernes Gefäß, Parierstange geht in den Griffbügel mit Balustern über. Muschelstichblatt. Der glatte Hilzenring und die Knaufkappe fassen den Hirschhorngriff , der zusätzlich mit 4 Eisennieten an der Angel fixiert ist (ein Nietenkopf fehlt). Zweischneidige Klinge mit 3 kurzen Hohlschliffen, Klingenzier und nicht zuordenbaren Symbolen. Länge 72 cm. Die morphologischen… Hirschfänger-774 weiterlesen